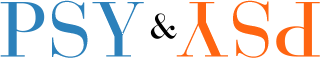
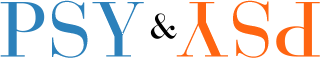
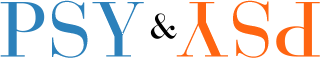
Seit der Einführung von TARPSY im Januar 2018 haben die psychiatrischen Kliniken nun zwei Jahre Erfahrung mit der neuen leistungsbezogenen Tarifstruktur für den stationären Bereich. Seit Januar 2019 ist die Anwendung von TARPSY auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbindlich. Eine erste Bilanz ...
Seit der Einführung von TARPSY im Januar 2018 haben die psychiatrischen Kliniken nun zwei Jahre Erfahrung mit der neuen leistungsbezogenen Tarifstruktur für den stationären Bereich. Seit Januar 2019 ist die Anwendung von TARPSY auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbindlich. Mit dem neuen Tarifsystem haben sich für die Psychiatrie zwei schon immer bestehende Herausforderungen verschärft a) die Bewältigung des administrativen Aufwands und b) die Planbarkeit der finanziellen Absicherung und der strategischen Entwicklung der Kliniken. Der administrative Aufwand ist zunächst durch die Bereitstellung der Infrastruktur für die Datenerfassung unter TARPSY-Bedingungen, die sowohl die Behandlungsteams, die Finanz- und Controllingabteilungen wie auch die IT betrifft, gestiegen.
Unter TARPSY haben sich auch die Anforderungen an die Qualität der medizinischen Kodierung erhöht. Da die Kodierung unter TARPSY einen Einfluss auf das Abgeltung hat, werden regelmässige Kodierrevisionen an definierten Stichproben der Behandlungsfälle durchgeführt, zur Überprüfung der korrekten Abrechnung von erbrachten Leistungen. Von Seiten der Versicherer werden seit der TARPSY-Einführung nun in steigender Zahl Rückfragen zur Spitalbedürftigkeit der Patienten gestellt, wodurch ein zusätzlicher, abgeltungsrelevanter und von TARPSY eigentlich unabhängiger Aufwand entsteht.
Noch nicht gelöst ist die angemesse Erfassung der CHOP-Codes, die erst nach 2jähriger Datenerhebung und einjähriger Analyse abgeltungsrelevant werden. Viele Kliniken erfassen die CHOP-Codes noch nicht oder nur unvollständig. Die Gründe hierfür liegen – laut Rückmeldungen der Kliniken – a) in der sehr aufwändigen Datenerfassung, b) in Problemen, die dort genannten Anforderungskriterien zu erfüllen und c) darin, dass bisher keine Abgeltung für kodierte Prozeduren erhalten wird und unsicher sei, ob dies jemals der Fall ist. In einem von U. Hemmeter (als Vertreter der SGPP) und Frau Ursula Althaus (Codierexpertin der FMH) auf der letzten SGPP Jahrestagung durchgeführten Workshop zeigte sich die noch äusserst heterogene Einstellung der stationärtätigen Psychiater zur Thematik der CHOP-Codes. Als Fazit ergab sich, dass CHOP-Codes eine Möglichkeit bieten, für Leistungen, die deutlich über die üblichen Behandlungsleistungen hinausgehen und damit einen kostentrennenden Charakter haben, eine zusätzliche Vergütung zu bekommen. Im Workshop zeigte sich aber auch, dass die Erfassung der CHOP-Codes mit den aktuell vorliegenden Kriterien mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden ist und daher die Kriterien – zumindest zum Teil – nochmals überdacht werden müssen.
Aufgrund des Wegfalls der bis Ende des Jahres 2019 geltenden Übergangsregelung zur Abgeltung von längeren therapeutisch oder altersbedingt indizierten Abwesenheiten der Patienten (z.B. an Wochenenden) ergab sich zuletzt eine Diskussion, die v.a. den CHOP-Code zur Belastungserprobung betrifft. Der Wegfall des während der Übergangszeit bis Ende 2019 zusätzlich bezahlten Tages würde – bei gleichbleibender Praxis der therapeutischen Beurlaubungen- für die Kliniken hohe finanzielle Einbussen ergeben. Von Swiss DRG wurde vorgeschlagen, dass unter der TARPSY-Version 3.0 ab 2021 Abwesenheiten aufgrund therapeutisch geplanter Belastungserprobungen abgeltungsrelevant werden könnten. Der errechnete Betrag von max. CHF 153.84 liegt jedoch deutlich unter dem jeweiligen Tagestarif. Daher wurde dieser Betrag nicht akzeptiert und die FMH beauftragt, die Abgeltung der Belastungserprobung unter Berücksichtigung der Vorhalteleistungen durch Swiss DRG überprüfen zu lassen. (Zudem wurden für die Erwachsenenpsychiatrie nur 3 Belastungserprobungen während des stationären Aufenthalts definiert, im Gegensatz zur Kinder- und Jugendpsychiatrie; dort können unbegrenzt Belastungserprobungen vorgenommen werden.)
Es besteht Einigkeit darüber, dass Patienten mit psychischen Erkrankungen im Rahmen der stationären Behandlung Belastungserprobungen (mit Übernachtung) zu Hause und/oder am Arbeitsplatz durchführen müssen und diese als Teil der gesamten stationären Therapie anzusehen sind. Aufgrund der klinischen Relevanz der Belastungserprobungen ist zu hoffen, dass es hierfür zeitnah (v.a. seit dem Wegfall der Übergangsregelung) zu einer adäquaten Abgeltung kommt, da sonst ein äusserst sinnvolles Behandlungselement der stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung aus ökonomischen Gründen zu wenig oder überhaupt nicht mehr eingesetzt werden kann. Insbesondere bei minderjährigen Patientinnen und Patienten ist dies für die Entwicklung von hoher Bedeutung.
Ein besonderes Merkmal von TARPSY ist, dass die Tarifstruktur laufend, auf der Basis von Daten, die zwei Jahre zuvor erhoben wurden, angepasst werden soll. Dies war beim Wechsel von 2018 auf 2019 (TARPSY-Version 2.0) der Fall.
Die Änderungen zwischen der TARPSY-Version 1.0 (2018) und der Version 2.0 (2019) waren nur gering. Insbesondere Patienten mit Schizophrenien, mit bipolaren Erkrankungen, sowie Patienten mit Co-Morbiditäten wurde etwas besser vergütet. Derzeit wird die TARPSY Version 3.0 vorbereitet, die im Jahr 2021 dann abgeltungsrelevant sein soll. Eine erste Präsentation der Version 3.0 im November 2019 hat in der anschliessenden Vernehmlassung durch die betroffenen Organisationen zu verschiedenen kritischen Eingaben geführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss abgewartet werden, welche dieser Kritikpunkte von Swiss DRG aufgegriffen und korrigiert werden. Erst dann kann eine weitere Diskussion zu diesem Thema sinnvoll und notwendig werden. Positiv zu vermerken ist, dass es in der neuen Version erstmals Zusatzentgelte für kostentrennende Leistungen geben soll, beispielsweise für die Behandlung mit teuren Depotneuroleptika und für 1:1-Betreuungen.
Unabhängig von den Änderungen in TARSPY 3.0 ist die geplante jährliche Anpassung der Tarifstruktur auf der Basis der zwei Jahre zuvor gelieferten Daten ein grosser Diskussionspunkt, da dadurch –aufgrund der potenziell immer jährlich wechselnden Kostengewichte für die PCGs (psychiatric cost groups) – eine exakte Budgetplanung (die dann ja meist schon weitgehend abgeschlossen ist) wie eine längerfristig angelegte strategische Planung, z.B. für die Entwicklung fachlicher und auch kostendeckender Schwerpunkte, sehr schwierig werden kann.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Kliniken sich mit dem Tarifsystem insgesamt arrangiert haben, jedoch viel Aufwand und Kosten in administrative Tätigkeiten fliessen, die direkt nicht nur die Mitarbeitenden der Supportdienste, sondern auch die am Patienten tätigen Berufsgruppen betreffen. Zudem besitzt das System noch viele Intransparenzen und teils nicht nachvollziehbare klinische Unschärfen und Definitionen (z.B. abgeltungsrelevante Nebendiagnosen), die eine Planbarkeit der klinischen Versorgung erschweren. Dies zu reduzieren und das Tarifsystem sukzessive an die klinische Realität der Patientinnen und Patienten anzupassen (soweit dies möglich sein wird) wird eine grosse Herausforderung für die Zukunft sein.