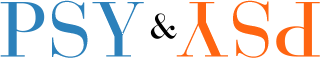
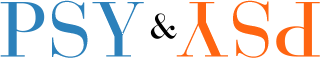
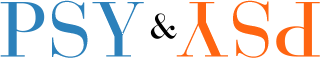

Bei den Persönlichkeitsstörungen zeichnet sich nicht nur beim Klassifikationssystem ein Paradigmenwechsel ab, indem zwei dimensionale Module zur Erfassung des Schweregrads und der Art der Persönlichkeitsproblematik eingeführt werden. Michael Kaess fordert zudem eine Ausrichtung auf eine frühe Diagnose und Intervention, damit Spätfolgen und Langzeitrisiken minimiert werden. Darüber spricht er an seinem Key-Referat am PSY-Kongress.
Lange hat man Persönlichkeitsstörungen, wie z.B. die Borderline-Störung, nur sehr zurückhaltend diagnostiziert, weil man die Jugendlichen schützen wollte. Die Diagnose einer solchen Störung war und ist bis heute schwer mit Stigma behaftet. Zusätzlich gab keine Idee einer effektiven Behandlung. Wir wussten zwar, dass die Krankheit in der Pubertät begann, behandelten diese aber erst im Erwachsenenalter. Zudem ist man früher von der falschen Grundannahme ausgegangen, dass Persönlichkeitsstörungen zum einen stabil und zum anderen nicht behandelbar sind. Zahlreiche Studien haben dies zwischenzeitlich wiederlegt. Wir wissen heute, dass Persönlichkeitsstörungen veränderbar sind. So zeigten Daten aus den USA, dass bei 80% der Betroffenen im Laufe von 10 Jahren, die Borderline-Störung verschwand. Persönlichkeitsstörungen sind mit Psychotherapie gut behandelbar, dies zeigen zahlreiche Interventionsstudien. Dies legte den Boden für die Frühdiagnostik und Frühbehandlung.
Wir wissen heute, dass die meisten Persönlichkeitsstörungen, so auch die Borderline-Störung in der Pubertät ihren Anfang nehmen. Je später wir diese Störungen behandeln, desto grösser ist das Risiko für Spätfolgen und Chronifizierung. Wenn Patienten erst als Erwachsene behandelt werden, verbessert sich zwar meist die Persönlichkeitsstörung, aber die Belegleiteffekte wie psychosoziale Defizite oder eine niderige Lebensqualität persistierten. Wir versprechen uns hier deutliche Verbesserungen durch die Frühintervention und vielversprechende Daten hierzu werden im Vortrag auch vorgestellt.
Die Entstehung von Persönlichkeitsstörungen ist bekanntermassen dem bio-psycho-sozialen Modell zuzuordnen. Dabei sind allerdings negative Kindheitserlebnisse wie Missbrauch oder Vernachlässigung für die Entwicklung solcher Störungen sehr relevant. In Heidelberg haben wir beispielsweise die «Bindungsthese» mittels einer Geburtenkohorte erforscht. Wir untersuchten die Bindungsfähigkeit der Mütter in den ersten zwei Lebenswochen der Säuglinge. Nun haben wir diese Kinder im 15. Lebensjahr wieder untersucht. Die Resultate zeigen deutliche Zusammenhänge zwischen der Bindungsunfähigkeit der Mutter und der Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen – dies vor allem bei Kindern mit bestimmten Temperamentsmerkmalen.
Zum Trend zur Frühintervention setzten wir in der Behandlung heute alle störungsspezifischen Therapieformen ein, die wir inzwischen für die Altersgruppe der Frühintervention adaptiert haben. Dazu setzen wir zunehmend auf Kurzzeitinterventionen, denn der Grundsatz «Viel hilft viel» dient nicht unbedingt für die Psychotherapie dieser Störungen. Dazu kommt, dass wir lieber kurze Therapien für viele Betroffene, als wenige Langzeittherapien für Einzelne anbieten.
Mein Ziel ist es, die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken anzuregen – insbesondere über die immer noch gängige Praxis in der Schweiz, Persönlichkeitsstörungen erst spät zu diagnostizieren und zu behandeln. Hier möchte ich mithelfen, den Paradigmenwechsel bezüglich des Behandlungszeitpunkts voranzutreiben – dies auch im Hinblick auf den grossen Nutzen für die Patienten.
Prof. Dr. med. Michael Kaess ist Ordinarius für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der Universität Bern und Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an der UPD in Bern. Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie wurde am Universitätsklinikum Heidelberg und am «Orygen Youth Health» in Melbourne ausgebildet. Im Fokus seiner Forschung stehen die Störungen der Stress- und Emotionsregulation im Kontext der menschlichen Entwicklung.