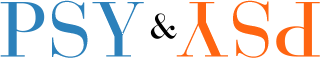
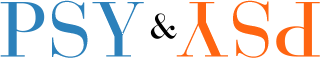
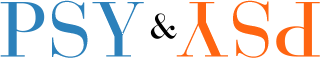
Professorin Anita Riecher-Rössler wurde mit dem diesjährigen Pascal-Boyle Preis der European Psychiatric Association (EPA) ausgezeichnet. Die Anerkennung beruht auf ihrem Engagement für die europäische Psychiatrie. Dr. med. Hans Kurt hat die Preisträgerin interviewt.

Heute ist klar, dass es grosse elterliche Einflüsse gibt, aber nicht so, wie man sich das damals vorgestellt hat. Am stärksten ist die Vererbung. Das elterliche und familiäre Umfeld kann jedoch einen Ausbruch oder den Verlauf einer Erkrankung bei genetischer Vorbelastung mitbeeinflussen, indem es als protektiver Faktor oder eher als Stressor und damit als Auslöser oder Verstärker von Symptomen wirkt. Es wäre aber ein Fehler, die Kausalität nur einseitig zu sehen, wie in den Anfängen der «Expressed Emotion»-Forschung. Damals wurde nur gesehen, dass in Familien mit hoher negativer Emotionalität der Verlauf der Psychosen schlechter war. Heute wird verstanden, dass bei einem schwereren Krankheitsbild die Eltern und die Familie auch stärker belastet sind, weswegen «high expressed emotions» entstehen. Eltern und Familien brauchen Unterstützung, um den Verlauf der Psychosen positiv zu beeinflussen bzw. bei beginnenden Erkrankungen vielleicht sogar deren Ausbruch zu verhindern.
Wir konnten Mitte der Achtzigerjahre – damals noch in der Arbeitsgruppe um Heinz Häfner in Mannheim – zeigen, dass schizophrene Psychosen bei Frauen deutlich später beginnen als bei Männern. Frauen haben dazu einen zweiten Erkrankungsgipfel nach dem 40. Lebensjahr. Auch fanden wir damals, dass über die Lebenszeit betrachtet, die Inzidenz bei Männern und Frauen gleich ist, wenn man die Ersterkrankung bis zum 60. Lebensjahr berücksichtigt und methodisch sauber alle Ersterkrankungen in einem grossen Einzugsgebiet einbezieht. Wir belegten wiederholt, dass es zwar verschiedene Geschlechtsunterschiede gibt – etwa in der Symptomatik, im Krankheitsverhalten, in der Neurokognition und im Verlauf – diese sind aber eher gering und vergleichbar mit der Allgemeinbevölkerung. Oft geht es also nicht um psychose-spezifische Unterschiede, sondern um allgemeine Geschlechtsunterschiede.
Sehr spannend ist der protektive Einfluss der weiblichen Sexualhormone, vor allem der Östrogene. Dieser schützt wahrscheinlich viele Frauen in jungen Jahren vor dem Ausbruch der Erkrankung. Wenn der Östrogenspiegel nach der Menopause abfällt, bricht die Krankheit aus. Während des Menstruationszyklus kann ebenfalls eine Besserung der Symptomatik oder der Neurokognition in Phasen mit hohem Östradiol-Spiegel beobachtet werden. Umgekehrt kommt es in der Niedrigöstrogenphase des Zyklus oder auch nach einer Geburt, wenn der Östrogenspiegel drastisch abfällt, zu mehr Rezidiven.
Wenn wir heute mehr und mehr über «personalisierte» Therapien reden, müssen wir bei wichtigen Personenfaktoren wie dem biologischen Geschlecht und dem psychosozialen Geschlecht anfangen. Geschlechtsspezifische Bedürfnisse ergeben sich zum einen aufgrund biologischer Geschlechtsunterschiede, z.B. bei der Psychopharmakotherapie, wo es wichtig wäre, die unterschiedliche Pharmakodynamik und Pharmakokinetik von Männern und Frauen zu berücksichtigen oder auch die Interaktion von Psychopharmaka mit Sexualhormonen. Auch in der Psychotherapie sollte auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern eingegangen werden. So haben Frauen häufig andere psychosoziale Risikofaktoren und Belastungen als Männer. Ich persönlich finde es wichtig, in der Psychotherapie der geschlechtsunterschiedlichen Sozialisation von Mädchen und Jungen Rechnung zu tragen. Diese hat schliesslich grossen Einfluss auf das spätere Rollenverhalten mit all seinen Konflikten sowie den Einschränkungen der Entfaltungsfreiheit für beide Geschlechter. Nicht nur die Geschlechterrollenstereotype des Umfelds können Patienten in eine bestimmte, nicht selbst gewählte und ungesunde Richtung drängen, sondern auch die eigenen internalisierten Stereotype und im Zweifelsfall auch die der Therapeuten. Wichtig ist mir auch gerade in der Psychotherapie von Frauen das Thema Abhängigkeit und Diskriminierung im Berufsleben und in der Partnerschaft oder sexuelle Belästigung, Missbrauch und häusliche Gewalt. Hilfreich ist es auch, «geschlechtertypische» Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen zu erkennen und zu hinterfragen. So zeigen Frauen im Allgemeinen ein schlechter ausgeprägtes Selbstwertgefühl und neigen zu Versagens- und Schuldgefühlen und damit depressiven Erkrankungen. Männer dagegen sind oft weniger bereit oder fähig, über ihre Gefühle zu reden und zeigen eher externalisierendes Verhalten.
Dies ist ein bisher noch ziemlich tabuisiertes Thema. Hier benötigen wir deshalb mehr Aufmerksamkeit, Kenntnis der Richtlinien und Weiter- und Fortbildung. Wir haben hier zur Prophylaxe für Kollegen auch den Selbstbeurteilungsfragebogen «Wahrung von Grenzen in therapeutischen Beziehungen» des College of Physicians and Surgeons of Ontario übersetzt (Franke & Riecher-Rössler 2011). Es geht aber nicht nur um Grenzüberschreitungen gegenüber Patientinnen, sondern auch um solche in abhängigen Beziehungen am Arbeitsplatz, also z.B. Benachteiligung aufgrund der Ablehnung von sexuellen Avancen. Junge Kolleginnen können hier nicht nur in grosse innere Konflikte, Ängste und Depressionen geraten, sondern auch in ihrer beruflichen Entwicklung behindert werden.
Hier stelle ich die Gegenfrage: «Kann das ein junger Mann? Kann auch er neben Familienwünschen, Weiterbildungsanforderungen und seiner Arbeit eine Laufbahn in der Forschung einschlagen?» Sie sehen, es geht um Geschlechterrollenstereotype, auch unsere eigenen internalisierten, die wir abbauen und hinterfragen sollten. Leben und Arbeit zu integrieren, sich selbst zu verwirklichen in allen Belangen sollte für beide Geschlechter möglich sein. Nicht nur Frauen sollte die Möglichkeit geboten werden, beruflich Karriere zu machen und Familie zu haben, sondern auch Männer sollten dazu ermuntert werden, sich intensiv in die Vaterrolle einzulassen. Um solche gesellschaftlichen Prozesse etwas zu beschleunigen, braucht es eine andere Kindererziehung mit weniger traditionellen Rollenvorbildern und sehr frühe, schon in der Schule und Ausbildung startende Mentoring-Programme über Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Anreize dafür müssten durch vielerlei strukturelle Veränderungen geschaffen werden, z.B. einen gesetzlich verankerten, viel längeren Vaterschaftsurlaub, das Recht auf Arbeitszeitreduktion für beide Geschlechter in der Familienphase, Quotenregelungen, Benchmarking und Anreize für Arbeitgeber, gleiche Gehälter für beide Geschlechter, Anreize bei der Steuer etc.Der Abbau traditioneller Rollen würde zur Entfaltungsfreiheit aller beitragen und wäre förderlich für die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft.
Ich bin überzeugt, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Gesellschaft auch zur psychischen Gesundheit von Frauen beiträgt. Ein Beispiel dafür ist der bekannte Gender Gap bei Depressionen, nämlich die Tatsache, dass Frauen weltweit im Durchschnitt etwa doppelt so häufig an Depressionen erkranken wie Männer. Dieser Gender Gap scheint sich aber in denjenigen Ländern langsam zu reduzieren, in denen die Geschlechterrollen an Traditionalität verloren haben, wie eine kürzlich publizierte grosse WHO-Studie zeigte (Seedat et al. 2009). Sie sehen, Prophylaxe ist mir sehr wichtig. Wenn es aber trotzdem zu psychischen Erkrankungen kommt, dann haben Früherkennung und möglichst gute, geschlechtersensible Diagnostik und Behandlung für mich einen hohen Stellenwert. Hierfür bräuchten wir geschlechtersensible Leitlinien zur Diagnostik und Therapie psychischer Erkrankungen, eine viel stärkere Berücksichtigung dieses Aspektes in unserer Aus- und Weiterbildung sowie anhaltende Supervisionsangebote. Dies gilt nicht nur für Psychiaterinnen und Psychiater, sondern für alle an der Versorgung psychisch Kranker Beteiligten.

Prof. Dr. med. Anita Riecher-Rössler ist Professorin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel PUK, wo sie das Zentrum für Gender Research und Früherkennung von Psychosen leitet. Sie hat sich intensiv mit den spezifischen Aspekten psychischer Störungen von Frauen beschäftigt. 1998 wurde sie als erste Frau im deutschsprachigen Raum auf eine Professur für Psychiatrie berufen. Prof. Riecher Rössler ist Past President der Internationalen Vereinigung für die psychische Gesundheit von Frauen (IAWMH) und Chefredaktorin des Archives of Women’s Mental Health. Sie hat als erste Preisträgerin die Ehrung am EPA Kongress in Nizza diesen Frühling erhalten.
Der Pascal Boyle Preis beruht auf der Arbeit von zwei Pionierinnen in der Psychiatrie im frühen 20. Jahrhundert. Dr. Constance Pascal war eine rumänische Psychiaterin, die 1908 als erste Frau als Psychiaterin in Frankreich arbeitete und 1925 Chefärztin einer psychiatrischen Klinik wurde. Dr. Helen Boyle, eine irisch-britische Psychiaterin, begann 1894 ihre Arbeit in England und wurde zur ersten Präsidentin des späteren Royal College of Psychiatry. Die EPA verleiht den Preis ausschliesslich an Frauen, die sich für die Psychiatrie in Europa – in der Patientenversorgung und Forschung – verdient gemacht haben.