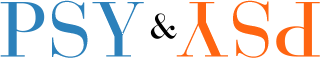
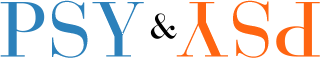
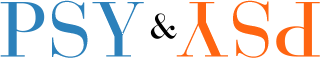

Frank Urbaniok ist bekannt. Medientitel bezeichnen ihn als Star unter den Gerichtspsychiatern. Anders als viele seiner Kollegen haben ihm die Gitterstäbe keine Grenzen gesetzt. So hat er viel bewegt: öffentlich rund um den gesellschaftspolitischen Diskurs über den Umgang mit Straftätern und fachlich mit der Ausrichtung auf eine konsequent Delikt-orientierte Psychotherapie. Seine Arbeit hat die moderne forensische Psychiatrie nachhaltig geprägt.
«Täterbehandlung sei Opferschutz», sagt Frank Urbaniok, einer der renommiertesten forensischen Psychiater im deutschsprachigen Raum. Ziel sei es, die Rückfallquote zu senken. Dies scheint ihm gelungen zu sein. Sie lag im Psychiatrisch-Psychologischen Dienst (PPD), den er von 1997 bis 2018 als Chefarzt leitete, für Gewalt- oder Sexualdelikte bei ca. fünf Prozent. Das war in all den Jahren rekordverdächtig tief. Urbaniok hat Medizin studiert mit dem Ziel, Psychiater zu werden. «Die Verbindung von Geistes- und Naturwissenschaften und dieses im Alltag umzusetzen, interessierte mich», sagt er. Die Psychiatrie ermöglichte ihm, über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Instrumente zu entwickeln.
Seine Facharztausbildung absolvierte Frank Urbaniok Anfang der Neunziger Jahre in der Rheinischen Landesklinik Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf. Er, der seine Psychotherapieausbildung bereits während dem Medizinstudium in Münster startete, arbeitete als Assistenzarzt zuerst auf einer Suchtaufnahmestation: «Ich habe Psychiatrie von Anfang an gerne gemacht – auch die Notfalldienste». Dann wurde er beauftragt, eine Modellstation für die Behandlung von persönlichkeitsgestörten Sexualstraftätern aufzubauen. Rückblickend sagt er: «Es war ein spannendes und wegweisendes Projekt, nicht nur hatte ich viel Autonomie, wir hatten auch ein eigenes Gebäude im Spitalareal». Es war die Zeit, in der Frank Urbaniok die konsequent Delikt-orientierte Psychotherapie entwickelte, die als Langenfelder Modell bekannt wurde. Das intensive Psychiatrie- und Psychotherapiemodell beinhaltete u.a. die Deliktrekonstruktion, versuchte kognitive Verzerrungen aufzulösen und einen Erklärungskontext für die Tat zu finden und zu bearbeiten. Damit sollten bei den Betroffenen ein Wachsamkeitspegel erzeugt und Risikoentwicklungen frühzeitig erkannt werden. Während die Betreuung dieser Straftäter vorher eine Art ambulante Therapie im stationären Umfeld war, umfasste diese die ganzen 24 Stunden des Tages. Das gesamte Team wurde zum Therapeuten, Informationen waren alle transparent, was anfangs bei Aussenstehenden keine Begeisterungsstürme auslöste. Sie fürchteten, die Pflege werde überfordert. Untersuchungen zeigten aber im Gegenteil eine hohe Zufriedenheit gerade des Pflegepersonals. Die Teamentwicklung bekam einen neuen Stellenwert: «Was die Patienten lernen sollen, mussten wir als Team können und vorleben». Und das schloss alle Mitarbeiter ein.
Patienten lernten auch, Verantwortung zu übernehmen, erzählt er: «Wurde davor in der Bewohnerversammlung das Thema «Küchenordnung» debattiert, übernahm das Betreuungsteam meist die Problemlösung. Danach haben wir das zurückgegeben und die Patientengruppe lernte, das autonom zu regeln. Das Prinzip: Wir regelten so viel wie unbedingt nötig, aber so wenig wie möglich. Selbstverantwortung der Patienten war Trumpf. «So konnten wir Dinge machen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann», sagt er. So wollten die Bewohner in der Freizeit eine Woche lang auf einen Campingplatz: «Wir haben Sie dann beauftragt, Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen und selber ein Konzept dafür zu entwickeln». Dies habe gut funktioniert. Die Arbeit mit Gewalt- und Sexualstraftätern sieht er pragmatisch. Auf die Frage nach dem Umgang mit dem Bösen, winkt Urbaniok ab. Moralmodelle lösen das Problem nicht. Vielmehr interessiere ihn die Erklärung des Delikts: «Das, was ein Mensch tut und wie er es tut, sagt etwas über den Menschen aus, der es tut». Hat ein Delikt Planungselemente, kann es nicht im Affekt erfolgt sein, sagt er. «Wir suchen nach Plausibilitäten zwischen Verhalten und Delikt und gleichen das ab, mit dem was ein Täter beschreibt.» 1995 kam Frank Urbaniok als Oberarzt in die Zürcher Justiz. 1992 hatte ein Sexualmörder auf einem Hafturlaub erneut zugeschlagen und am Zollikerberg eine junge Frau ermordet. «Auch drei Jahre danach stand die ganze Justiz noch unter Schock. Man fragte sich, was läuft falsch und was können wir besser machen. Die Risikobewertung und die Verringerung von Rückfallgefahren waren brennende Themen», sagt er. Eineinhalb Jahre später wurde er zum Chefarzt befördert und sollte das bisherige System neu ausrichten. Er etablierte das deliktorientierte Arbeiten, sein teamorientiertes stationäres Psychotherapiemodell und baute die forensische Psychiatrie um und auf. Von sechs Mitarbeitenden wuchs der PPD auf 60 Mitarbeitende, die jährlich rund 1’500 Täter betreuten. Die Forensisch-Psychiatrische Abteilung in der Strafanstalt Pöschwies, in der Täter hochintensiv und quasi rund um die Uhr behandelt werden, ist sein Kind.
Für die Risikoanalyse hat Urbaniok das standardisierte System Fotres (Forensisches Therapie-Risiko- Evaluations-System) entwickelt. Es handelt sich um ein eigenständiges risikoorientiertes Diagnosesystem. Urbaniok ist überzeugt, dass es eine kleine Gruppe extrem gefährlicher, nicht therapiebarer Straftäter gibt. Wie der Mörder vom Zollikerberg, der vorher 30 Eigentumsdelikte, 11 Vergewaltigungen und 2 Sexualmorde begangen hatte. «Für alle anderen müssen wir alles tun, damit sie nicht mehr gefährlich sind. Neben dem Schuld- und Strafprinzip vertritt er deshalb das Präventionsprinzip, denn 99% aller Straftäter werden irgendwann entlassen. «Ohne Therapie sind die meisten nach wie vor gefährlich.» Es brauche differenzierte Risikoprognosen und Therapien, aber auch Verwahrungen in einigen wenigen Fällen. Frank Urbaniok war Mitglied der Arbeitsgruppe des Bundesrats zur Umsetzung der Verwahrungsinitiative, die vom Volk angenommen wurde. In der Schweiz kann ein Täter verwahrt werden, wenn dieser ein schweres Delikt begangen hat, eine hohe Rückfallgefahr besteht und er schlechte Therapiechancen hat. Die lebenslängliche Verwahrung ist für extrem gefährliche und absolut untherapierbare Gewalt- und Sexualstraftäter vorgesehen. Diese Differenzierung erhitzt aktuell im Fall «Rupperswil» die Gemüter. Urbaniok zufolge «können psychiatrische Diagnosesysteme eine Aussage über eine Krankheit machen, aber nicht über die Gefährlichkeit eines Täters». Allgemeinpsychiatrische Klassifikationssysteme nach ICD oder DSM sind darum ungeeignet, um Risiken zu erfassen. Psychiatrische Diagnosen erklären also ein Delikt nicht. Deswegen gibt es FOTRES. Die Gutachter haben den Täter im Fall Rupperswil für therapierbar erklärt, weil sie die gestellten Diagnosen für therapierbar halten. Sie haben aber selber eingeräumt, dass mit diesen Diagnosen die Tötung von vier Menschen nicht erklärt werden kann. Urbaniok hat daraufhin folgenden Einwand gebracht: «Wenn man aber nicht weiss, warum jemand eine Tat begangen hat, dann weiss man auch nicht, was sich ändern müsste, damit das Risiko für einen Rückfall sinkt. Deshalb kann man nicht sagen, dass er therapierbar ist.»
Seine Kritik am Rupperswiler Gutachten brachte ihm den Tadel ein, er greife die Unabhängigkeit der Justiz an. Doch Urbaniok kontert: «Die richterliche Unabhängigkeit wird nicht dadurch gefährdet, dass man eine Fachmeinung äussert. Der Richter kann doch selber beurteilen, ob ihn die Meinung überzeugt oder nicht.» Aber er räumt ein: «Ich mische mich gerne ein und stelle mich der öffentlichen Diskussion.» Denn die forensische Psychiatrie befinde sich an der Schnittstelle von Psychiatrie, Justiz, Politik und Öffentlichkeit. Es komme hier eben auf die Interpretation der Rolle an. Urbaniok scheut kein Thema, sagt auch Dinge wie «kluge Menschen wissen, dass Macht immer ein flüchtiges und eigentlich oberflächliches Phänomen ist». In der Bevölkerung geniesst Urbaniok wegen seiner offenen und klaren Kommunikation und seiner Expertise grosses Vertrauen. Seine Familie hat er konsequent aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Morddrohungen hat er zahlreiche bekommen. Er arbeitete viel in den vergangenen Jahren, war jederzeit verfügbar. Als Universitätsprofessor hat er mehr als 100 Bücher, Buchbeiträge oder Fachartikel als Allein- oder Mitautor verfasst. Im Sommer trat er wegen einer Krebserkrankung nach 21 Jahren als Chefarzt des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes des Kantons Zürichs zurück. Heute arbeitet er wieder als Gutachter, Therapeut und Dozent mit stark reduziertem Pensum. Seine Erkrankung bezeichnet er als grosse Zäsur in seinem Leben: «Was ich früher an einem Tag gemacht habe, erledige ich nun in einer Woche». Wie vieles in seinem Leben, geht er auch das pragmatisch an.
Der Professor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Frank Urbaniok, hat die forensische Psychiatrie in den vergangenen 25 Jahren geprägt wie kein anderer. Über zwanzig Jahre war Urbaniok Chefarzt des Psychiatrisch Psychologischen Dienstes (PPD) im Justizvollzug des Kantons Zürich. Heute arbeitet er als Therapeut, Supervisor und Gutachter in eigener Praxis. Der Verfechter des spezifischen deliktorientierten Behandlungsansatzes ist Begründer des Modells der Teamorientierten Stationären Behandlung (TSB). Er entwickelte ein eigenes Diagnosesystem als Qualitätsmanagement- und Dokumentationsinstrument für Risikobeurteilungen bei Straftätern (FOTRES) sowie zahlreiche Therapieprogramme und -methoden. Professor Urbaniok war auch Mitglied der Arbeitsgruppe des Bundesrats zur Umsetzung der Verwahrungsinitiative und Teilnehmer diverser politischer Expertenhearings auf nationaler und internationaler Ebene.