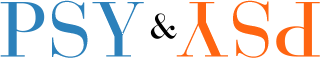
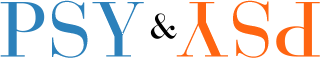
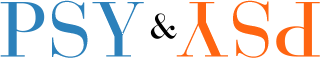

Eine Krise birgt auch Chancen für neue Lösungsansätze. So auch die Coronaviruspandemie, die die «virtuelle» Sprechstunde neu positionierte. Nun gilt es den Nutzen herkömmlicher und neuer Sprechstunden zu maximieren und deren Einsatz optimal abzustimmen.
Ungefähr einmal pro Generation kommt es zu einer globalen Pandemie, weshalb zur Bewältigung der hiermit einhergehenden Herausforderungen nur sehr begrenzt auf frühere Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Die Covid-19-Pandemie erfüllt somit die grundlegenden Kriterien einer Krise. Eine solche ist unter anderem durch die Notwendigkeit charakterisiert, auf bisher nicht angewandte Lösungen zurückzugreifen, respektive gänzlich neue Lösungen zu entwickeln. Eine wesentliche Herausforderung der diesjährigen Covid-19-Pandemie war, und ist weiterhin, der Zugang zu psychiatrischen Diensten bei gleichzeitiger Garantie infektionspräventiver Massnahmen.
Durch eine schnelle Ausdehnung telemedizinischer Angebote lässt sich die zu erwartende plötzliche Lücke in der Versorgung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu grossen Teilen schliessen. Der Begriff Telemedizin bezeichnet medizinische Prozeduren (Diagnostik, Therapie etc.) unter Überbrückung einer räumlichen oder zeitlichen Distanz mithilfe elektronischer Kommunikationstechnologien. In letzterem Fall spricht man von asynchronen Interventionen (z.B. Mail, SMS etc). Telekommunikationsmittel können hierbei zwischen Fachleuten und Patienten zum Einsatz kommen (Frontoffice), oder zwischen den Fachleuten (Backoffice).
Die Anwendung telemedizinischer Mittel ist zwar nicht neu, es wurde in den letzten Jahren auch immer wieder mit wechselndem Erfolg versucht, entsprechende Angebote zu fördern. Das Angebot Plattformen mit qualitativ hochwertiger Videoübertragung und garantierter Vertraulichkeit ist zudem in den letzten Jahren gestiegen. Diese sind entweder spezifisch für den Gesundheitsbereich entwickelt worden oder lassen sich im Allgemeinen schnell auf dessen besondere Bedürfnisse anpassen. Beispiele sind Zoom, Blue Jeans, Doxy.me, Thera-LINK, TheraNest, SimplePractice und Vsee. Mit Ausbruch der Pandemie hat die Telemedizin und im Besonderen auch die Telepsychiatrie einen erfreulichen Aufschwung erfahren.
Die Psychiatrie eignet sich in besonderem Masse für die Anwendung telemedizinischer Mittel, basiert sie doch, im Vergleich zur restlichen Medizin, in grösserem Masse auf dem Gespräch. Bereits vor der Covid-19 Pandemie haben zahlreiche spezifische Untersuchungen aufzeigen können, dass die «virtuelle Sprechstunde» für psychiatrische Patienten und Fachleute in vielen Fällen eine akzeptable Alternative zur traditionellen Konsultation ist. Die insbesondere von Patienten geschätzten Vorteile sind unter anderem Flexibilität, der Komfort des privaten Umfelds (Gefühl der Normalität und/oder der massgeschneiderten Intervention), der Wegfall von Wegzeit und Wegkosten. Es gibt in der Zwischenzeit auch hinreichend wissenschaftliche Evidenz bezüglich Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und insbesondere Verbesserung des Zugangs zur psychiatrischen Versorgung. Die heute zur Verfügung stehen Kommunikationsmittel können hierbei sowohl im Patientenkontakt (Frontoffice) als auch in der Organisation der Behandlung (Backoffice) wertvoll sein.
Ein weiterer, selten diskutierter Aspekt des Aufschwungs der Telepsychiatrie – aber vielleicht längerfristig der interessanteste – ist die Tatsache, dass er den Übergang zu einer zugänglicheren, kollaborativeren, patientenzentrierteren gemeindenahen Psychiatrie fördert und hoffentlich beschleunigt.
Eine Krise bringt definitionsgemäss die Chance für neue Lösungsansätze mit sich, andererseits aber auch möglicherweise zur Verschärfung und/oder Chronifizierung gewisser Probleme. Zu den Risiken gehört sicherlich der Rückfall in eine allzu rigide Steuerung der Aktivität, welche den derzeitigen Innovationselan brechen könnte. Algorithmierte Prozeduren sehen Neuerungen vorerst nicht vor und können so das Krisenbewältigungspotenzial reduzieren. Ein weiteres Risiko ist aber auch der Missbrauch der neuen Kommunikationsmittel als Überwachungsmittel. So bringt zum Beispiel Homeoffice einiges an Freiheiten, aber auch das Risiko der Verwischung der Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem.
Die Covid-19-Krise hat zwar einiges in Schwung gebracht, nun gilt es jedoch darum den Schwung beizubehalten, das Erreichte zu festigen, und weitere Entwicklungen zu fördern. Telepsychiatrische Angebote waren bisher in der Schweiz noch eher die Ausnahme, und es ist davon auszugehen, dass auch nach Abflauen der Epidemie ihre routinemässige Anwendung einiges an Förderung bedarf. Es liegt jetzt in erster Linie an den Institutionen, das entstandene Momentum zu nutzen, die Angebote beizubehalten, zu stärken, die Techniken und Erfahrungen zu teilen und Late Adopters zu motivieren. Die Integrierung telepsychiatrischer Aspekte in die Weiter- und Fortbildung sollte eine der Prioritäten sein. Auch muss dem Abbau von Technologiebarrieren (sowohl bei Patienten als auch bei den Ärzten) besondere Aufmerksamkeit zukommen. Eine Förderung der Anwendung von Teletechnologien in wissenschaftlichen Studien (z.B. mit verstärktem Einsatz von Ecological Momentary Assessments) dürfte dem Momentum ebenfalls zuträglich sein.
Eine der Herausforderungen wird sein, traditionelle und «virtuelle» Sprechstunden zeitlich und in der Abfolge so zu integrieren, dass der Nutzen beider Methoden maximiert werden können. Schliesslich soll auch auf das Risiko hingewiesen werden, dass im Überschwang die persönliche Begegnung eventuell vernachlässigt wird und aus einem anfänglichen Physical Distancing im wahrsten Sinne des Wortes ein Social Distancing wird.
Daniele Zullino ist Chefarzt der Klinik für Suchtkrankheiten im Departement für Psychiatrie und Psychiatrie des HUG und Mitglied der psyChiatrie-Redaktionskonferenz der FMPP.